Interview Anna SINOFZIK | Fotografie Robert RIEGER
Mag sein, dass wir in Zeiten der Pandemie für Aspekte der Raumteilung sensibilisiert sind. Aber bemerkenswert ist es doch, dass eine der produktivsten Verbindungen der Berliner Architekturszene mit der Gestaltung von Trennwänden begann. Mit Hygienemaßnahmen hatten Letztere allerdings nicht viel zu tun. Es waren die Neunzigerjahre, Long Island, New York. Der Rest ist Erfolgsgeschichte — und zwar die des Duos Gonzalez Haase AAS. Wir blicken mit den beiden zurück zu ihren Anfängen, in einige der schicksten Büros, Boutiquen und Galerien der Gegenwart — und in eine Zukunft, in der von manch aktuellen Problemen vielleicht nicht viel mehr geblieben sein wird, als ein blasses Hellblau.

»Das Gebäude war eine Ruine«, erinnert sich Judith Haase an den »einmaligen Ort«, an dem sie Pierre Jorge Gonzalez das erste Mal traf. Es war der vierte Sommer, den die frisch diplomierte Architektin aus Deutschland in der ehemaligen Forschungsfabrik des Unternehmens Western Union verbrachte, die unter Leitung des Theaterkünstlers Robert Wilson in ein Kulturzentrum transformiert werden sollte. Einst war hier das Eingabeinstrument des ersten Faxgeräts entwickelt worden, nun trafen Kreative aus verschiedenen Nationen und Disziplinen aufeinander, um gemeinsam an Theaterstücken oder Installationen zu arbeiten — und die »Ruine« nach und nach in den berühmten Campus zu verwandeln, den die New York Times mal als »zeitgenössisches, weltoffeneres Bayreuth« beschrieb. Der junge Szenograph Pierre Jorge Gonzalez, der gerade erst per Stipendium von der L‘École nationale supérieure des Arts Décoratifs in Paris nach New York gekommen war, wurde der Architektengruppe zugeteilt, die für den Umbau des Gebäudes verantwortlich war.

»Wir verstanden uns schnell und entwarfen zusammen Details für die Trennwände in den Proberäumen«, erzählt Haase. »Da ich derzeit kein Französisch sprach und er kein Englisch, kommunizierten wir ausschließlich über Skizzen.« Judith Haase und Pierre Jorge Gonzalez beschreiben Wilsons »Watermill Center« als kreativen Melting Pot, der ihre eigene Arbeitsweise maßgeblich beeinflussen sollte. »Die Energie der gemeinschaftlichen Design Sessions, die ganze Atmosphäre am Center — das hat mich fasziniert«, sagt Gonzalez. »Interdisziplinär zu arbeiten, auf verschiedenen Ebenen, wobei eine die andere inspiriert, das war prägend für uns«, ergänzt Haase. Auch heute komme die Kraft ihrer Zusammenarbeit vor allem durch die Kombination komplementärer Einflüsse zustande — beruflicher und kultureller.

»Pierre Jorge ist in Frankreich aufgewachsen, die Filme der Nouvelle Vague, in denen Regisseure die volle künstlerische Kontrolle übernahmen und auf inszenatorische Aus- drucksformen setzten, haben seinen Ansatz geprägt«, erklärt Haase. Sie als Architektin sehe jedes Projekt zunächst von seiner bautechnischen Seite. Wenn beide Perspektiven aufeinandertreffen, ihre architektonische mit seiner szenografischen — wohl auch die Sachlichkeit deutschen Designs mit dem Charme des französischen Autorenkinos der späten Fünfziger- und frühen Sechzigerjahre — dann entstehen jene Reibungsmomente, die die Handschrift des Duos ausmachen und so imposante Räumlichkeiten hervorbringen, wie den MCM Store in München, die Vitra Booth für den Mailänder Salone del Mobile oder das Restaurant Ernst in Berlin.
Haase und Gonzalez arbeiten seit 1999 zusammen, zunächst von Berlin und Paris aus, in den frühen Nullerjahren hat das Duo die deutsche Hauptstadt zum Sitz ihres Büros gemacht. Da sie all ihre Projekte bis zur Bauüberwachung persönlich betreuen, sei die Niederlassung an dem Ort nötig gewesen, an dem sie die meiste Arbeit hatten, begründet Haase die Entscheidung pragmatisch, während Gonzalez auf die Aura der Stadt verweist: »Berlin hatte etwas Einzigartiges, vor allem wenn man aus geschäftigen, dicht bevölkerten Großstädten wie Paris oder New York kam. Als wir in den späten Neunzigern in den USA lebten, gab es in unserem Umfeld viele Leute, die im künstlerischen Bereich arbeiteten und nach dem richtigen Ort suchten, um eine Karriere zu beginnen.« Als Metropole im Umbruch, in der Raum wenig kostete, aber extrem viel passierte, lag Berlin hoch im Kurs. »Überall entstanden neue Galerien, Ateliers, die Kulturinstitutionen der Stadt mussten neu aufgebaut werden. Ein ganz besonderer Moment in der Geschichte.«

Als sie ankamen, habe die Stadt ihnen enormen Handlungsfreiraum gegeben, das Gefühl, die Umgebung aktiv gestalten zu können, war für Gonzalez essentiell. In den darauffolgenden Jahren haben Haase und er die schroffe Strahlkraft des Berliner Stadtbilds mitgeprägt — zunächst vor allem im kulturellen Bereich, mit minimalistischen Galerieräumen, freigelegten Industriedecken und viel rohem Beton. Heute ist ihr souveräner Minimalismus längst in Couture-Häusern, Haute Cuisines, und eleganten Wohnhäusern der Welt angekommen. Ihre Wahlheimat hat sich indes gewandelt. »Mittlerweile hat Berlin sich in vielerlei Hinsicht anderen Großstädten der Welt angeglichen«, sagt Gonzalez. »Der große Unterschied besteht für uns aber darin, dass wir mit der Stadt wachsen konnten. Das urbane Umfeld, der kulturelle Kontext, die ganze Körperlichkeit Berlins macht auch weiterhin vieles möglich, es besteht also kein Grund nostalgisch zu sein.« Haase stimmt zu. »Ich nehme Veränderungen grundsätzlich positiv wahr. Bewegung und Weiterentwicklung sind mir sehr wichtig. Berlin ist viel internationaler geworden und auch wir arbeiten inzwischen global, sind weniger auf die Stadt fixiert, als wir es mal waren.« Als Lebensmittelpunkt bleibe sie aber inspirierend — gerade weil sie sich so schnell verändert und viele Menschen aus der ganzen Welt anzieht.

Wie in anderen Metropolen wird bezahlbarer Lebensraum in der Spreestadt mittlerweile recht knapp. »Wenn Raum Luxus ist, sollte man ihn erst recht nicht mit Objekten vollstellen«, sagt Gonzalez, auf die Kargheit angesprochen, die sich mit der Beständigkeit eines industriellen Stahlseils durch Gonzalez Haase AAS’ Portfolio zieht. Im Grunde ginge es ihnen weniger um Reduktion, als darum, »den richtigen Dingen den richtigen Raum zu geben« und klare räumliche Rhythmen zu schaffen. Früher, sogar noch bevor Gonzalez seine Liebe zur Nouvelle Vague entdeckte, habe der spanische Regisseur Carlos Saura, insbesondere dessen Tanzfilme, sein ästhetisches Empfinden beeinflusst, erzählt der Szenograph, dessen Eltern als spanische Immigranten nach Frankreich kamen, um »akzeptable Arbeit« zu finden. Die Low-Budget-Szenerien, das Leben, das sich nach der Diktatur des Franco Regimes gerade zu öffnen begann, all das habe ihn beein- druckt und inspiriert.
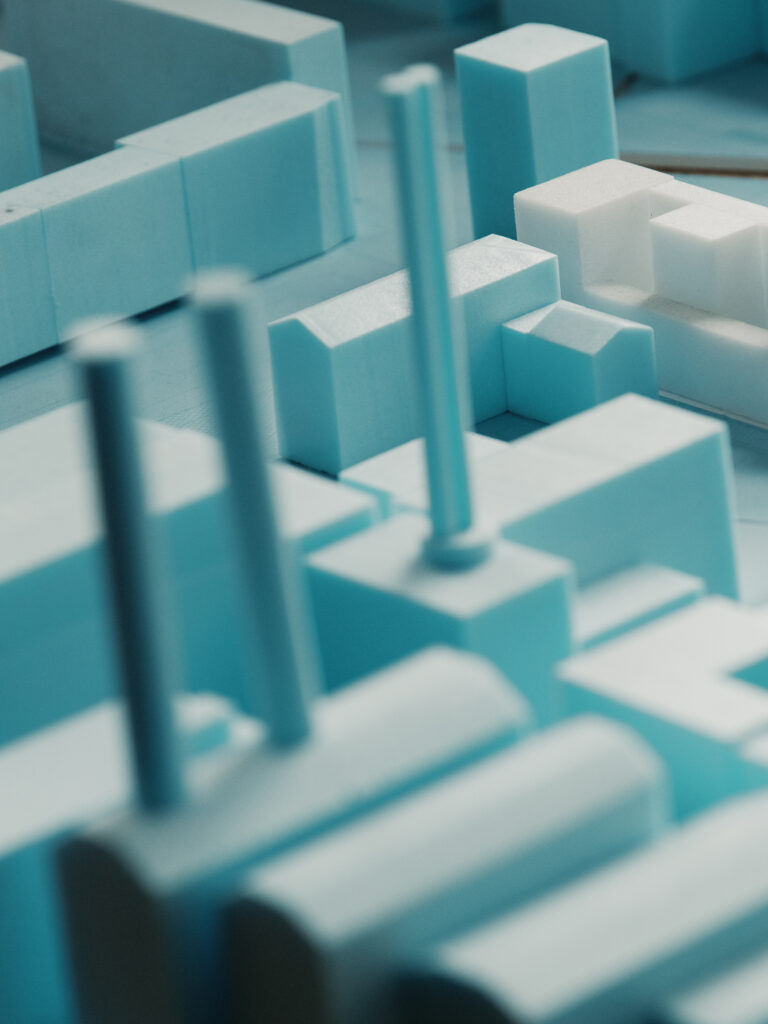
»Wenn unsere Räume auf den ersten Blick auch kühl erscheinen, haben sie doch immer etwas Echtes, Ehrliches an sich«, betont er. Dazu trage die Klarheit der Strukturen sowie die Lichtführung bei. »Wir setzen Licht gern so, dass der komplette Raum erhellt ist, nichts versteckt bleibt. Die ganze Konstruktion ist darauf angelegt, sich visuell und haptisch komplett zu erschließen.« Authentizität in den baulichen Strukturen, ihrer Beleuchtung und der Materialwahl ist für Gonzalez und Haase auch ein Mittel, um dem Individuum die gebaute Umgebung nahezubringen. »Wir schaffen die Struktur, die Basis, welche die BewohnerInnen dann zum Leben erwecken«, so Haase. Gefragt, wie sie selbst lebe, gibt die Architektin preis, dass es bei ihr privat weit weniger aufgeräumt aussehe, als auf den Bildern ihrer Projekte. »Ich habe eine Tochter und einen Hund und liebe auch den chaotischen Moment im Leben. Wir haben viele marokkanische Berberteppiche zu Hause, auch in Knallfarben, und leben praktisch auf diesen Teppichen. Nach dem Lockdown bin ich allerdings froh, das Wohnliche nur zu Hause und nicht im Büro zu haben. Ich kann mich in neutralen Räumen besser auf das Wesentliche konzentrieren.« Vielen ihrer KundInnen scheint es ähnlich zu gehen. So sind auch die Büros, die Gonzalez und Haase gestalten, recht reduziert.

Die Digitalisierung bringt neue Bedingungen mit sich, auf die die Raumgestaltung reagieren muss. Dabei gilt es auch, maschinell-funktionale Anforderungen mit menschlichen abzustimmen und in Einklang zu bringen. »Wir arbeiten immer eng mit unseren Auftraggebern zusammen und die meisten haben eine klare Vorstellung davon, wie sie gerne arbeiten«, erklärt Haase. »Vor Kurzem haben wir das Büro des Grafikers Mirko Borsche in München fertiggestellt. Er hatte um einen großen langen Tisch gebeten, an dem all seine Mitarbeiter mit ihren Laptops arbeiten können. Er sagte: »Je enger wir räumlich zusammenarbeiten, desto kürzer ist unser Arbeitstag.«

Mit der räumlichen Nähe ist es ja gerade so eine Sache. Viel Arbeit hat sich nach Hause verlagert, man verbringt mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. »Bei mir zu Hause sind die Räume nicht besonders klar definiert«, bekennt Gonzalez. »Ich mag es, wenn jedes Zimmer unterschiedliche Funktionen erfüllt und zu verschiedenen Zwecken genutzt werden kann. Mag sein, dass solch fließende Zonen die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit aufheben, aber mir tut es gut, den Arbeitsplatz innerhalb der Wohnung immer wieder wechseln zu können, es hält mich wach.« Wochenlang Homeoffice — für ihn also gar kein Problem? »Grundsätzlich mag ich es, zuhause zu arbeiten. Aber natürlich ist die Dynamik eine ganz andere. Der Austausch im Team treibt Ideen voran.« Ob in räumlicher oder zwischenmenschlicher Hinsicht: Sich innerhalb einer Arbeitsumgebung wohlzufühlen habe für ihn einen ähnlichen Effekt, wie ein gutes Outfit: »Es schafft Selbstvertrauen.« Und damit wohl auch besseren Output.
Gonzalez lebt in einem Gebäude, das er und Haase gestaltet haben, bis hin zum Mobiliar — welches sie jedoch nicht als solches im eigentlichen Wortsinn verstehen. »Wir entwickeln Möbel grundsätzlich so, dass sie zu groß und schwer sind, um mobil zu sein«, erklärt Gonzalez. Ortsspezifische Objekte träfe es in der Tat sehr viel besser, stimmt Haase zu: »Wir sehen sie im Grunde als skulpturale Architekturen oder Installationen, die direkt mit dem Raum, in dem sie stehen, korrespondieren.« Es ist ein Ansatz, der den Marketingstrategien kommerziellen Industriedesigns ebenso widerspricht, wie dem Mobilitätsanspruch unserer Zeit. »Designobjekte, die für einen bestimmten Raum konzipiert sind, sind heute selten, weil sie der Logik des modernen Lebens nicht folgen«, meint Gonzalez. »Ich finde die ortsspezifische Gestaltung aber extrem spannend — mit allen Herausforderungen, die sie mit sich bringt.« Es ist eine Herangehensweise, die den Dialog von Raum und Objekt, die Ordnung der Dinge, in den Vordergrund stellt — und gewisse Hierarchien und Bedeutungszusammenhänge zu hinterfragen scheint. Gehören manche Dinge eher der Umgebung an, als dem Menschen, der sie bewohnt? Warum sollte das, was für die natürliche Umwelt gilt, nicht auch auf gebaute Räume zutreffen? Interessant sei auch, was passiert, wenn man das Objekt dann doch mal außerhalb des angedachten Kontexts platziert, findet Gonzalez: Unter Umständen könne es auch dort relevant sein, gar eine ganz neue, unerwartete Bedeutung erlangen.

»Die Tatsache, dass all unsere Objekte für den festen Einbau gedacht sind, hat großen Einfluss auf die Relationen im Raum«, erklärt Haase. Gleiches gilt für die Lichtgestaltung, die ein wesentlicher Aspekt eines jeden Entwurfs ist. »Wir behandeln Licht als architektonisches Element, das den Raum definiert.« Die produktivsten, spannendsten Momente des Gestaltungsprozesses seien die, in denen ihre unterschiedlichen, »extremen Auffassungen« zusammentreffen. »Am Ende suchen wir die Mitte und integrieren ein merkwürdiges Element, etwas, mit dem keiner rechnet«, sagt Haase. Als Beispiel nennt sie eine antennenartige Installation in der Berliner Modeboutique von Andreas Murkudis: Die Antenne reiche vom Boden bis zur Decke, ohne eindeutige Funktion. Es sind solche »verstörenden Elemente«, in denen das Duo die kritische Dimension seiner Arbeit manifestiert sieht.

»In der Innenarchitektur sind kritische Ansätze selten und auf den ersten Blick mag man fragen, wie und warum die Gestaltung einer Modeboutique überhaupt kritisch sein kann«, gibt Gonzalez zu. Die Kunst sei jedoch ein gutes Beispiel dafür, dass sich auch aus dem kommerziellen System heraus Kritik üben ließe. »Kern unserer Idee ist der Anspruch, den Raum nicht völlig vom Auftraggeber kontrollieren zu lassen. Natürlich gehen wir auf seine Bedürfnisse ein, bedenken aber immer auch, was der Endverbraucher eigentlich braucht. In einem Geschäft ist es zum Beispiel Kernziel der Marke, räumliche Strukturen zu schaffen, die den Gewinn maximieren. Das ist normal und nachvollziehbar. Der Konsument möchte aber nicht manipuliert werden. Wir wollen klare, ehrliche Umgebungen schaf- fen.« Es gäbe genug Werbung da draußen, genug Hinweise und Regeln — gerade in Zeiten wie diesen.
Inwieweit fühlen sie sich als Gestaltende in der Verantwortung, auf die neuen Herausforderungen der Gegenwart zu reagieren? »Wenn wir Restaurants planen, dann ist das natürlich ein Bereich, in dem man intensiv über Hygienemaßnahmen nachdenken muss«, sagt Haase. »Wir bekommen von unseren Kunden ein Raumprogramm und wenn spezielle Maßnahmen gefordert sind, müssen wir kreativ werden. Neue Herausforderungen sind aber immer gut und ich bin mir sicher, dass wir gute Lösungen finden, ohne, dass man sie direkt wahrnehmen wird.«
»Es ist naheliegend, Architekten und Raumgestalter mit Lösungsansätzen für das Problem zu betrauen«, fügt Gonzalez hinzu. »Aber es ist auch wichtig, die politischen Entscheidungsträger im Blick zu behalten, die die Voraussetzungen für so eine Pandemie überhaupt erst geschaffen haben und sie in die Verantwortung zu nehmen. Das wirkliche Problem besteht doch darin, dass die Kosten immer von den Gleichen getragen werden und die Politik in Denkmustern der Achtzigerjahre feststeckt. Als Gestaltende können wir temporäre Lösungen anbieten. Am Ende soll Design«, so Gonzalez, »vor allem das Leben verbessern.« Doch gute Gestaltung entwickelt sich in direkter Korrespondenz mit der Zeit, ihren spezifischen Gegebenheiten und den kulturellen Gewohnheiten, die daraus hervorgehen. »Unser Zusammenleben hat sich in den vergangenen Monaten grundlegend verändert und ich habe das Gefühl, dass es auch eine Zeit lang leider so bleiben wird«, sagt Haase.
Und danach? Was bleibt von all den Provisorien, den plexigläsernen Paravents, den Weltverbesserungsvorsätzen? Zumindest wohl: eine vage Erinnerung, vielleicht auch: eine Farbe. In ihrem Buch The Catastrophe Colours, das Haase und Gonzalez bereits 2014 herausgebracht und seither in verschiedenen Ausstellungen — wie kürzlich im KINDL-Zentrum für zeitgenössische Kunst — installativ umgesetzt haben, ordnen sie verschiedenen Katastrophen ihre eigene Farbe zu. Damit möchten sie die assoziative Wahrnehmung von bestimmten Farbwerten komplett auf den Kopf stellen, erklärt Gonzalez. »Mit Katastrophen assoziieren wir meist vor allem die Bilder, die wir aus den Medien kennen, die eigentlichen Geschehnisse entziehen sich unserer Vorstellungskraft.« Die Hypothese, auf der das künstlerische Forschungsprojekt beruht: Die mentalen Nachbilder, die sich nach Katastrophen und Krisen ins kollektive Gedächtnis einbrennen, sind mediale, menschliche Konstrukte — genau wie Farbtrends der Innenarchitektur.

Es gehe um den Versuch, »Farben ihre anhaftende Poesie zu entziehen«, so das Duo. »Wir weisen Farbtönen, von denen die meisten konventionell ja eher mit poetisch-floralen Namen und Assoziationen verknüpft sind, eine neue Bedeutung zu.« Zwar entsteht im Zuge des Projekts kein Farbfächer im Sinne von Le Corbusiers Clavier des Couleurs, gestalterisch anwenden lässt die Palette sich dennoch. Der Architekt Sam Chermayeff, ein guter Freund von Gonzalez und Haase, war der erste, der das Buch auf diese Weise genutzt hat: Als er das Haus eines anderen Freundes, des Journalisten und Autors Georg Diez, gestaltet hat, bat er ihn, Farben aus der Publikation auszuwählen, erzählt Gonzalez. Genug Farben für ganze Einrichtungskonzepte hat der Fächer jedenfalls längst und an Krisen und Katastrophen, um das Spektrum kontinuierlich zu erweitern, mangelt es nicht. The Catastrophe Colours ist ein fortlaufendes Projekt, so Gonzalez, auf Basis aktueller Nachrichtenmeldungen ließe es sich beinahe täglich aktualisieren.
Welchen Farbton hat die Coronakrise? »Für mich Giftgrün«, sagt Haase. »Das Hellblau der Masken, die wir gerade überall sehen«, entgegnet Gonzalez. »Oder die bunten Töne der Illustrationen des Virus, die wir ständig in den Nachrichten sehen.« Und wofür nutzen die beiden die Ruhe der kommenden, gesellschaftlich wohl weitgehend gedrosselten Wintermonate? Auf welche neuen Highlights arbeiten sie hin? »Durch die Pandemie haben wir viele Projekte, die mit Bewirtung zu tun haben, verloren oder sie wurden auf Eis gelegt«, sagt Haase. Davon abgesehen liefe es aber weiterhin gut. »Solange wir Arbeit haben und dazu noch Auftraggeber, die unsere Arbeit schätzen, ist das ein Highlight«, so die Architektin. »Wie Louise Bourgeois schon sagte: I am not what I say — I am what I do.«


