Text Anna SINOFZIK
Wie immer leben wir in Zeiten des Wandels. Und wie immer gibt es die, denen die Veränderung willkommen ist — in Opposition zu jenen, die fürchten die Vorherrschaft gleite ihnen durch die durchschnittlich großen, zur Faust geballten Hände. Was macht der verwirrte Mann, in Zeiten Trump’scher Machtspiele, nach #MeToo und #TimesUp? Welche Form von Männlichkeit stirbt da gerade zu Recht tausend Tode? And what’s art got to do with it?
Es hängt über der westlichen Welt seitdem Frauen angefangen haben, für ihre Rechte zu kämpfen — doch angeblich war das Ende des Mannes niemals so nah. Näher vielleicht, als es der Weltuntergang vor dem Millennium war. Unausweichlich wie alte feministische Slogans, die eine neue, weibliche Zukunft feiern. In der Politik feilen mittelalte weiße Männer an alternativen Zukunftsmissionen. Es werden sich Gedanken gemacht, Erkenntnisse angehäuft, Schlüsse gezogen und publiziert. Ein paar Jahre nachdem die amerikanische Journalistin Hanna Rosin durch Talk Shows tingelte, um ihr Buch The End of Men zu promoten, brachte der britische Künstler Grayson Perry The Descent of Man heraus — und wortwitzelnd Darwins Evolutionstheorien ins Spiel. Weniger endgültig, aber durchaus wie vom Angesicht irgendeines Todes getrieben raten uns dieser Tage Zeitungen und Onlinemagazine, den »man code« umzuschreiben und »bessere Männer zu erschaffen«.

Natürlich begrüßen wir das Ende, das Rosin, Perry und andere Feministen in ihren Büchern beischreiben. Wenn die aktuellen Schlagzeilen und Tweets ihn schon immer lebendiger erscheinen lassen: die Zukunft des Machos soll bitteschön schwarz sein wie die Lunge des Marlboromans. Im eigenen Umfeld meint man ihn bereits jetzt vor allem als Persiflage oder Provokation anzutreffen; ab und an mal im getuneten BMW an der Ampel. Sobald irgendwelche Auswüchse totgesagter Machtstrukturen zu zucken beginnen, weiß man sie einzuordnen, irgendwo zwischen What-the-Fuck und fremdschämerischem Phantomschmerz. Klar ist jedoch auch: The end is not everyone’s friend. Manch einen lässt es zunächst mal verstörter zurück, als man denkt.
»The Boys Are Not All Right«, titelt der Comedian Michael Ian Black in der New York Times. Bei praktisch allen Amokläufen an amerikanischen Highschools haben junge Männer den Abzug betätigt. Black führ es mitunter darauf zurück, dass sie sich isoliert, verwirrt und verunsichert fühlen, weil sie die eigene, männliche Identität und all die Erwartungen, die daran geknüpft sind, als zunehmend widersprüchlich empfinden. Er möchte Mut machen, seinem eigenen Sohn zeigen, wie man mit der eigenen Verletzlichkeit umgeht und über Gefühle spricht, schreibt er, aber er könne es nicht. »Because I was a boy once, too.«
Während vergleichsweise wenige verunsicherte Boys ihre Schulkameraden erschießen, richten weltweit immer mehr Männer die Waffe gegen sich selbst. Aktuellen Studien zufolge sind sie heute vermehrt von Depressionen betroffen und weil vergleichsweise wenige Hilfe annehmen, steigt die männliche Selbstmordrate beständig. Im Rap, dessen Protagonisten plötzlich mehr über Gefühle reden als einem lieb ist, werden psychische Störungen samt schonungsloser Seelen-Striptease zum Must-Have. Immer öfter wird das selbstsichere »suck my dick« dabei durch lebensmüde Lines à la XXXTentacion ersetzt. »I’m sad and low, yeah«, säuselte der — doch bevor er seinen »suicide« wahr machen konnte, hat ihn ein anderer verwirrter Junge erschossen.

»If we don’t teach men emotional literacy, they might well end up living lonely, unhealthy, shorter lives«, schreibt Grayson Perry in The Descent of Man.
Die feministische Kulturwissenschaftlerin Jaclyn Friedman schlägt vor, vermehrt auf Initiativen zu setzen, die männlichen Schulkindern helfen, auch Eigenschaften an sich schätzen zu lernen, die traditionell als weiblich gelten. »Too many boys are trapped in the same suffocating, outdated model of masculinity, where manhood is measured in strength, where there is no way to be vulnerable without being emasculated, where manliness is about having power over others«, bestätigt sie Michael Ian Black in der Times.
Er sähe es gern, wenn mehr Männer sich den Feminismus zur Inspiration nehmen würden, »in the same way that feminists used the civil rights movement as theirs.«
Neben Comedians, Rappern und Kulturwissenschaftlern setzen sich Marketingabteilungen mit der Frage auseinander, was es heute eigentlich heißt, ein Mann zu sein. Axe hat im vergangen Jahr seine Boys do Cry Kampagne gestartet; Gillette propagiert die softe Seite des Mannes mit dem Clip Handle with Care, in dem ein fürsorglicher Sohn mittleren Alters seinem pflegebedürftigen Vater bei der Rasur mit dem ersten »assisted shaving razor« hilft. Stockfoto-Gigant Getty Images bekundete unlängst die Verantwortung der Massenmedien, Alternativdarstellungen zur toxischen Alpha-Männlichkeit zu bieten — und präsentiert eine kuratierte Bildsammlung als Gegengift: Unter dem Titel Masculinity Undone bietet man Fotos liebevoller Väter und brainstormender Teamworker an. Ansonsten stolpert Gettys moderner Mann vor allem ungelenk durch den Haushalt oder blickt sehnsüchtig in die Ferne — wahrscheinlich in Hoffnung auf eine bessere Zukunft, jenseits von Klischees und Gegenklischees.
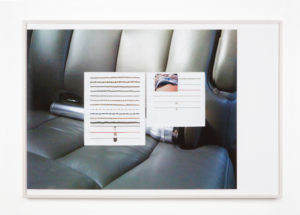
Falls er vorerst Probleme hat, sich von der Vergangenheit zu lösen, kann er sich bei einer der Selbsthilfegruppen anmelden, die weltweit damit werben, verunsicherten Männer Unterstützung zu bieten. Ganz im Geiste des ersten Men’s Movement, das sich in den Siebzigerjahren in Anlehnung an die Frauenbewegung formierte, positionieren sich einige progressiv und profeministisch. Andere agieren vor allem als Anlaufstelle für Männer, die Nachhilfestunden in Menschlichkeit suchen. Der britische Journalist Richard Godwin, der die Gruppe Rebel Wisdom bei einigen Sessions besuchte, zitiert den Claim der Gruppe im Guardian:
»In today’s world, for men to be vulnerable and speak their truth is an act of rebellion.«
Naturgemäß ist rebellieren produktiver als jammern. Godwins Bericht lässt jedoch Zweifel daran, ob die selbsternannten Rebellen den Unterschied sehen: »In practice, (…) we were going to spend a day doing breathing exercises, talking about our fathers, pretending to be tigers, leaning on one another, (…) and trying to articulate why we all felt so defensive and angry and misunderstood so much of the time.« Man muss zugeben, die ganze Debatte ist ein bisschen vergiftet. Wer »masculinity« bei Google eingibt, der bekommt als eine der oberen Auto-Fill-Options » … is toxic« vorgeschlagen. Aber auf die Gefahr hin, irgendwelche neuentdeckten Gefühle zu verletzen: Wenn aus allen Ice Cubes bald weinerliche XXXTentacions würden, hätten wir tatsächlich gute Gründe zum Heulen. In Michael Ian Blacks Worten hieße das, der heutige Mann habe »only two choices: withdrawal or rage.«


Die sogenannten ›Men’s Rights Activists‹ haben Letzteres gewählt, um ihre Ideale vorm Untergang zu bewahren. Als Zusammenschluss bekennender alt-rechter, antifeministischer und anderer frustrierter Männer ist die Gruppe auch unter der Abkürzung MRA bekannt, die rein zufällig dem Akronym der National Rifle Association ähnelt. Während man anderswo die Gleichberechtigung vorantreibt, verteidigen die Men’s Rights Activists ihr altbewährtes Männerbild mit militanten Ausdrucksformen und stahlharter Borniertheit. Auch in Deutschland wächst gerade eine Männerbewegung, die vor einem »omnipräsenten Staatsfeminismus« warnt, der ihrer Ansicht nach jegliche Männlichkeit unterdrücke. Der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung zufolge handelt es sich um eine Splittergruppe der Väterrechtsbewegung, deren Anhänger sich vor allem von Jugendämtern diskriminiert fühlen, die dabei jedoch »deutlich ideologisierter« und stärker in der rechten verankert ist.

Von rechten Aktivisten grenzt sich die Website The Art of Manliness ab, die neben Körperpflege- und Styling-Tipps eine Reihe Schritt-für-Schritt Anleitungen zu all jenen »manly skills« bietet, die ihre Redakteure wiederbelebt oder bewahrt sehen möchten. Man gibt sich gentlemanlike, als Familienmensch und Frauenversteher. Um seiner Rolle als stolzer Beschützer gerecht zu werden, setzt man sich aber auch gern damit auseinander, wie man bei einer Schlägerei den größten Schaden verursacht oder sein Fahrrad als Waffe einsetzt. Entsprechende Ratschläge ergänzt man mit netten Pfadfindertricks und Essays, in denen zumindest anerkannt wird, dass die Kunst der Männlichkeit untrennbar mit sozio-philosophischen Aspekten der Identitätsbildung verknüpft — und daher kaum definierbar ist.

© LIFE Magazine; Photo: Life Magazine
Umso überraschender ist, dass Männlichkeit in der Kunst für viele immer noch recht klar definiert scheint. Obwohl KünstlerInnen seit Generationen am klischierten Bild rütteln, bleibt es eng mit bestimmten Vorstellungen verbunden. Mit schweren Materialien, deren Bearbeitung besonderer physischer Stärke bedarf. Mit radikalen Pinselstrichen. Mit Land Artists in Cowboystiefeln, die die Prairie mit Planierraupen eroberten. Mit Michael Heizer zum Beispiel, der im Zuge seiner Arbeit Double Negative beträchtliche Teile eines Canyons wegsprengte. Vielleicht noch mit der »ejakulativen Geste« eines Cyprien Gaillard, die Kritiker in dessen Arbeit Real Remnants of Fictive Wars, eine Reihe in der Wildnis ausgelöster Industriefeuerlöscher, hineininterpretierten. Rechts des Spektrums verteidigt der mürrische Georg Baselitz weiterhin seine Ansicht, dass die Aggressivität, welcher jegliche erfolgreiche Malerei bedürfe, durch und durch männlich sei.

Double Negative, 1969,
Mormon Mesa, Nevada
© Retis, flickr.com
Nicht nur in der Malerei sterben Positionen wie die des alten Baselitz zu Recht tausend Tode. Die Gender-Debatte ist größer denn je in der Kunst. So groß, dass sie einem mitunter schon auf den Geist geht — besonders wenn sie wieder mal am Ziel vorbeischießt oder sich obsoleten Strukturen bedient, anstatt sie grundsätzlich zu hinterfragen. Interessant ist, dass die üblichen Verdächtigen, wie der queere Grayson Perry, der uns pink lackierte Motorräder präsentiert, Rollenklischees heute weniger wirkungsvoll brechen, als Künstler, die sich nicht explizit als feministisch positionieren. Wenn Claudia Comte (gern in Cowbowstiefeln) mit einer Kettensäge Baumstämme bearbeitet, macht sie das mit der Selbstverständlichkeit, die wir brauchen. — Nicht nur, weil Niki de Saint Phalle ihre Shooting Paintings schon vor Jahrzehnten mit der Shotgun produziert hat. Anstatt der eigenen Männlichkeit gleich die Kugel zu geben, interpretiert manch junger Künstler das vermeintliche Ende des stahlharten Manns mit dessen eigenen Mitteln.
»Though construction materials have featured in art by all genders, when employed here by two cis-male artists, it’s hard not to read their chosen medium through the lens of masculinity«, kommentiert Andrew Berardini eine Ausstellung von Stephen Neidich und Steve Hash, die diesen Sommer in LA stattfand. Unter Hashs Exponaten befand sich eine Skulptur aus italienischem Marmor, aus der die definierten Formen abgetrennter männlicher Gliedmaße im klassizistischen Stil hervortraten; außerdem ein hängendes Handtuch in Gussbeton. Neidich zeigte eine Serie von Objekten, zum Beispiel einen Auspufftopf oder einen von einer Gardinenstange durchbohrten Benzinkanister, die in klarem Harz eingefasst in der Luft zu hängen schienen. »Sucked tight in the stiff, translucent material, these otherwise useful, butch things are preserved and rendered utterly useless, impotent,« schreibt Berardini. In Neidichs Arbeiten sieht er Artefakte eines sterbenden Zeitalters, für Archäologen der Zukunft in den Schwebezustand versetzt; Hashs marmorne Skulptur prange indes wie ein Grabstein über der zukünftigen Gruft des Patriarchats.

Neidichs und Hashs Ausstellung trug den Titel Abraham & Sons Inc. — eine Anlehnung an Søren Kierkegaards Buch Fear and Trembling, das um die biblische Geschichte Abrahams gestrickt ist. Als »Vater vieler Völker«, der in allen drei großen Weltreligionen von Bedeutung ist, bietet sich Abraham als Big Daddy einer globalen Identitätskrise an. Aber trotz Anspielungen auf eine gewisse Impotenz (hier vor allem im Sinne geistiger Ohnmacht) bleiben die Arbeiten von Neidich und Hash offen für positive Interpretationen. Wie auch Ian Markells Installationen, die der ausgelutschten phallischen Form horizontale Elemente entgegensetzen. »It’s not about passivity«, erklärt der Künstler, »rather about the idea of timelines or a body laying down.« Die größte Kraft der Kunst liegt in ihrer Verweigerung, sich selbst vollständig zu erklären. Es ist eine Kraft, die sie mit der Genderidentität gemein hat, als einer der vielen, wankelmütigen Facetten des Selbst.
Ein gutes Vierteljahrhundert bevor Hanna Rosin und Grayson Perry The End of Men und The Descent of Man publizierten, brachte der feministische Aktivist John Stoltenberg The End of Manhood heraus. Der Untertitel, A Book for Men of Conscience, verweist auf die banale Tatsache, dass »bessere« Männlichkeit eine Sache von gesundem Menschenverstand ist — und keine der Kastration. »Better models of masculinity are everywhere, if you know where to look«, schreibt die feministische Autorin Jaclyn Friedman, die ihre Freunde und Bekannten befragt hat, um herauszufinden, wie er denn eigentlich ist, dieser »neue Mann«, den wir in Zukunft häufiger sehen wollen. Die Antworten, die sie bekam, waren vielfältig. Neben Frank Ocean und Barack Obama wurde »Bob« aus der animierten Sitcom Bob’s Burgers genannt.
In Ian Markells letzter Ausstellung Nothing Now Anything Anytime gibt es zwei Fotos, aufgenommen von zwei Männern in unterschiedlichen Jahrzehnten, beide halten die Kamera nach unten auf die eigene Hose gerichtet. Es ist eine Pose, die an Pierre Bourdieus Ausführungen zum Habitus als Verkörperung von Machtstrukturen erinnert. Zeiten des Wandels sind Zeiten der Bestandsaufnahme, vielleicht auch der Verunsicherung. Das sind sie schon immer. Was wir weiterhin brauchen, sind Ideen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die sich in erster Linie als Menschlichkeit definieren. Das erste und vielleicht einzige, was dafür sterben muss, sind rigide Rollenklischees.

