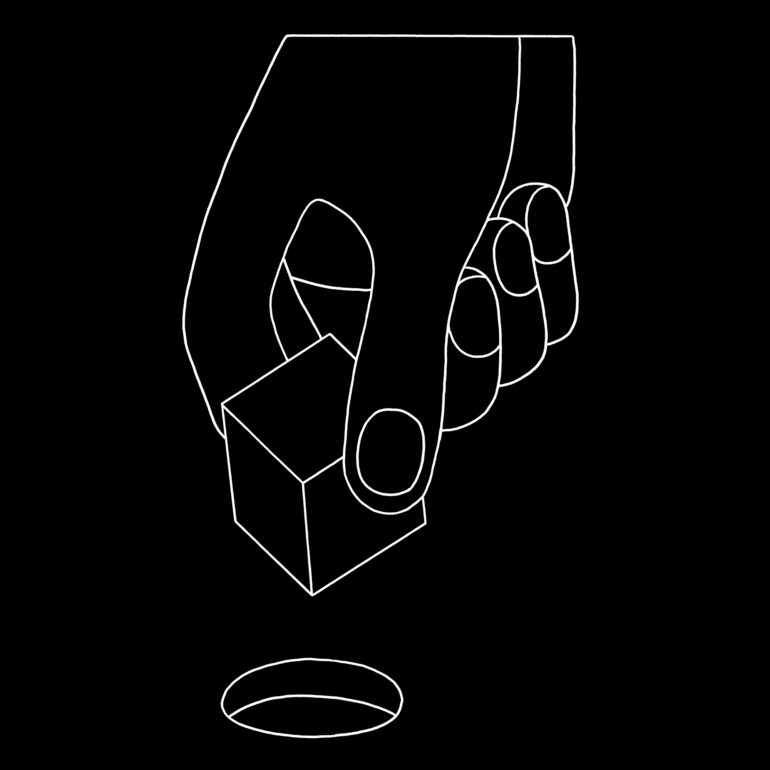Text Anna SINOFZIK | Illustration João DRUMOND
Wie wollen wir leben, in einer Welt, in der nichts sicher scheint, aber alles erreichbar ist? Je schneller die Meeresspiegel steigen, Produktzyklen verstreichen und Cyber Mondays aufeinanderfolgen, desto wichtiger wird es, Prioritäten zu setzen. Die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn gute Entscheidungen und klare Prinzipien gehören zu den stärksten Währungen dieser sogenannten postfaktischen Welt. Aber woran wollen wir glauben? Was wollen wir trinken? Dürfen wir noch mit dem Diesel zum Biomarkt (oder sogar den Skiurlaub) fahren? Woody Allen gut finden? Und warum halten wir so gern an Konzepten fest, die am Ende doch nicht ganz aufgehen?
Während gewohnte Weltordnungen wanken und Wissenschaftler berechnen, wie lange unsere Ressourcen noch reichen, duftet es in der eigenen Echokammer nach Fairtradekaffee und einer etwas smarteren Zukunft. Zumindest gibt es einen groben Konsens; ein Stück Common Ground, auf dem es so gemütlich sein kann, wie in Eames’ Lounge Chair: Man kauft regional, wohnt minimalistisch, unterschreibt Petitionen, verzichtet möglichst auf Fleisch, Fast Fashion und falsche Positionen. Insgesamt leistet man sich und seiner Umwelt eine vergleichsweise große Bandbreite der berühmten kleinen Beiträge, die die Welt gerade so dringend braucht. Es ist eine Lebensweise, mit der man zunächst mal ganz gut fährt. Selbst wer hin und wieder Easyjet fliegt, darf annehmen, dass die Klimaziele vor allem andere brechen. Die mit den Topshop-Tüten zum Beispiel, oder die in den SUVs. Vielleicht noch ein paar #richkidsofinstagram, die ihr dekadentes #jetsetlife abfeiern als wären dies die Achtzigerjahre. Wer heute »gut leben« will, der meint immer seltener Glamour und Bling-Bling; immer häufiger einen bewussten Lifestyle, geprägt von Understatement, Achtsamkeit und Moral. Es gibt genug Wege und Waren, die den guten alten Hedonismus vertretbarer machen. Man kennt das Klischee der großstädtischen »Avocadotoast-Esser« (ORIT GAT, Avocadospace, Affidavit, 2017) in ihren Patagonia-Pullis, zu deren erweiterten Kreisen man sich mitunter etwas widerwillig selbst zählen muss. Wie die Soziologin Elizabeth Currid-Halkett schreibt, steht die Zweieurotomate vom Erzeugermarkt vielerorts längst höher im Kurs, als herkömmliche Luxusartikel (ELIZABETH CURRID-HALKETT, The Sum of Small Things, 2017). Wenngleich klar ist, dass die eigenen, unscheinbaren Statussymbole im Bourdieu’schen Sinne eine Form von Kapital — und damit auch sozialer Ungleichheit — sind (PIERRE BOURDIEU, La distinction. Critique sociale du jugement, 1979), erscheint einem so eine Werteentwicklung zunächst mal als Fortschritt und vermeintlicher Sieg der Vernunft.

Sea Horse Holding on to a Cotton Swab
In einer Gegenwart, die einerseits von Unsicherheiten,andererseits von enormem Wohlstand geprägt ist, wird alles — vom Wochenendeinkauf bis zur Wohnungseinrichtung — zum politischen Akt. Doch wie überall, wo Zusammenhänge komplexer sind, als wir sie gerne hätten, bilden sich polarisierende Camps. Wer dieser Tage allzu genüsslich mit dem silbernen Löffel in seinem Chia Pudding rührt, wird schnell zur neuen, »aufstrebenden Klasse« gezählt, die neoliberalen Tendenzen zum Trotz in allen Bereichen des Lebens eine bessere, vernünftigere Version ihrer selbst sein möchte. Sicher gibt es sie, die Patrick Batemans der »Bionade-Bourgeoisie« (KATHRIN HARTMANN, Ende der Märchenstunde. Wie die Industrie die Lohas und Lifestyle-Ökos vereinnahmt, 2019). Aber auch ohne Sarkasmus, Eliten-, oder Gutmenschen-Bashing steht der Vorwurf der Doppelmoral in der dicken, feinstaubbelasteten Luft. Denn besonders für all jene, die ihn halbwegs ernst nehmen, erweist sich der Kampf um eine etwas bessere Welt als ständiger Konflikt mit sich selbst. Umso bewusster wir leben, desto mehr unbequeme Fragen wollen beantwortet werden, desto häufiger scheinen gut gemeinte Entscheidungen einen Haken zu haben. An die Vermutung, dass der Carbon Footprint unserer Bio-Avocados so unnötig groß sein könnte wie ein Buffalo Boot, haben wir uns halbwegs gewöhnt. Aber wer hätte gedacht, dass die rasant angestiegene Nachfrage in Neuseeland bereits wahre Kriminalitätswellen ausgelöst hat? Der Minimalismus, den wir lange als Ausdruck einer gewissen Konsumkritik sahen, scheint in seiner populärsten Form, nämlich der des erstaunlich leeren Lofts, vor allem eine mentale Fastenkur für Menschen zu sein, die sich notfalls alles neu kaufen können. Natürlich macht es keinen Sinn, weniger Bücher zu haben, um den Blick auf das Wesentliche (Erlebnisse! Erinnerungen!) und die schönen weißen Wände nicht zu verstellen, dafür aber haufenweise Kindleversionen. Welche Bruchteile der Welt lassen sich eigentlich auf die Art und Weise ernähren, die wir für uns selbst in Anspruch nehmen? Hätte es bei Karstadt doch bessere Tomaten gegeben? Zum Büffelmozzarella möchte man schon gern welche, die richtig schön rot sind. Und dann reicht das Kleingeld sogar noch für ’ne Dose Cola vom Späti.
Dem Unbehagen, das uns immer dann überkommt, wenn wir Dinge denken oder tun, die scheinbar nicht miteinander vereinbar sind oder unseren eigenen Ansprüchen und Vorstellungen widersprechen, hat der Sozialpsychologe Leon Festinger in den Fünfzigerjahren einen Namen gegeben: Kognitive Dissonanz. Ich habe das erste Mal in einem Hörbuch davon gehört (HARALD WELZER, Selbst Denken. Eine Anleitung zum Widerstand, 2013), als ich gerade auf dem Weg in den Skiurlaub war — also im Begriff, die Schönheit der Schweizer Alpen zu genießen und gleichzeitig kaputtzufahren. »Jeder Skifahrer, der unter seinem Helm ein funktionsfähiges Gehirn hat, wird sich schon einmal gefragt haben, was zur Hölle er da eigentlich für ein Hobby hat, und ob es nicht ein guter Vorsatz wäre, sich endlich ein neues zu suchen«, hat dazu mal jemand recht treffend geschrieben (JAKOB SCHRENK, Skifahren im grünen Bereich, ZeitOnline, 2015). Ich habe noch nicht mal einen Helm — den Artikel aber trotzdem weitergelesen. Natürlich gab es da zunächst Zitate von Umweltverbänden, die darauf hinwiesen, wie sehr der intensive Wintersport sein wertvollstes Gut, nämlich die Natur, gefährdet. Dann kam jedoch ein emeritierter Professor für Kulturgeographie zu Wort, der dazu riet, die Sache mal nüchterner zu betrachten: Dass die Alpen ein Hort der Ursprünglichkeit sind, sei eine so romantisierte wie realitätsferne Stadtmenschen-Vorstellung, man betriebe dort schließlich seit Jahrtausenden Ackerbau und rode Wälder. »Die sanften Almwiesen, die wir so sehr bewundern, sind nicht unberührte Natur, sondern von Menschenhand geschaffen.« Fachmännisch beweidet können Skipisten in den Sommermonaten angeblich intakte Vegetationsdecken ausbilden. Sogar Kunstschnee habe, dem Professor zufolge, mitunter einen positiven Effekt, weil er den Bergboden dünge! Wenn die rationale Rechtfertigung fehlt, ist man versucht, Wege zu finden, sich von der Vertretbarkeit seiner Handlungen zu überzeugen. Festinger und seine Kollegen haben im Laufe der Fünfziger- und Sechzigerjahre in einer Versuchsreihe demonstriert, wie weit Menschen mitunter gehen, um ihren inneren Konflikten etwas entgegenzusetzen. Im Informationszeitalter ist es leichter denn je, zu jeder Haltung die passenden Argumente zu finden und diese für den eigenen Zweck einzusetzen. Lässt einen der eigene Verstand einmal hängen, finden sich irgendwo im Internet die passenden Argumente. Im Kontext von Fake News und alternativen Fakten wird Festinger besonders in den USA gerade wieder öfter zitiert. Aber auch jenseits populistischer Lager wird fleißig mentales Yoga betrieben, um sich moralisch flexibel zu halten und das eigene Konzept so hinzubiegen, dass es so konsistent wie möglich erscheint.
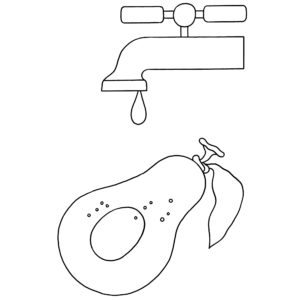
Unsere Bemühungen, Unstimmigkeiten in unserem Denken und Handeln zugunsten eines konsistenten Selbstbilds zurechtzurücken, erklären Sozialpsychologen mit dem Impuls der Dissonanzreduktion. Während sowohl aus politischer als auch evolutionstheoretischer Sicht soziale Motive im Vordergrund stehen (eine mehrheitsfähige Haltung zu haben ist meist überlebenswichtiger, als die moralisch richtige zu vertreten), hat der Psychologe Elliot Aronson besonders auf die Konsequenzen kognitiver Dissonanz für das individuelle Selbstkonzept hingewiesen. In Theories of Cognitive Consistency schreibt er: »Die Dissonanztheorie basiert nicht auf der Annahme, dass der Mensch ein rationales Lebewesen ist; sie versteht ihn viel mehr als rationalisierendes Lebewesen, dessen Ziel es ist, vernünftig zu erscheinen — vor anderen Menschen, aber auch vor sich selbst.« (ELLIOT ARONSON, Theories of Cognitive Consistency, 1969) In ihrem Bestreben, möglichst rational rüberzukommen, steht die motivierte Argumentation der Ironie gegenüber, dem Delphintattoo der Moral. Mit dem berühmten Augenzwinkern der Ironie lassen sich Fauxpas um das eigene Image drapieren, wie skurrile Flohmarktfunde auf dem Eiermannschreibtisch. Man kann behaupten, dass jede Ästhetik, also auch die der eigenen ideologischen Haltung, den Bruch braucht und beteuern, dass man es im Grunde natürlich besser wusste, als man den Megasparpack Silvesterraketen gekauft oder den Flug nach Thailand gebucht hat. Dem unterschwelligen Unbehagen, das einen befällt, können die Totschlagargumente der Ironie jedoch ebensowenig anhaben, wie Zynismus und Trotz. Und so wird überall in der westlichen Welt nach dissonanzgeglättenden Alternativen gesucht. Für besonders Leichtgläubige gibt es Biosiegel, für Fernreisefans schicke Bücher, die nachhaltige Boutiquehotels am anderen Ende der Welt präsentieren. Aber neben Vielfliegern, Skifahrern und Amazon-Prime Kunden brauchen selbst die Foodies vom Farmersmarket immer bessere Argumente: Den Vereinten Nationen zufolge wird die Weltbevölkerung bis zum Ende des Jahrhunderts auf beinahe elf Billionen anwachsen. Experten haben berechnet, dass es ohne die industrielle Landwirtschaft nicht gelingen wird, ausreichend Nahrung für alle zu produzieren. Um wirklich nachhaltig leben zu können, müssten wir nicht nur bewusster und grundlegend besser, sondern vor allem weniger konsumieren. Das mindert nicht den Wert nachhaltiger Verbraucherentscheidungen. Aber jeder Eco Hedonist, der unter seinem Everlane-Beanie ein funktionsfähiges Gehirn hat, weiß, welche Widersprüche der eigene Ethos in seinen Grundzügen birgt.
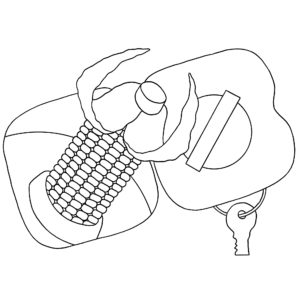
Laut Festinger gibt es neben dem klassischen moralischen Zwiespalt eine ganze Reihe von Auslösern, die zur kognitiven Dissonanz, und damit unmittelbar zum Impuls der Dissonanzreduktion, führen. Zum Beispiel neigen wir dazu, die eigenen (Selbst-)zweifel auszutricksen, wenn wir uns einem Projekt verschrieben haben, dessen Ergebnis den eigenen Erwartungen und Überzeugungen im Nachhinein nicht gerecht wird. Oder wenn wir eine Entscheidung treffen, obwohl die Alternativen ebenfalls attraktiv waren, sich vielleicht sogar als attraktiver herausstellen könnten. Das heißt, eigentlich ständig im alltäglichen Leben. Im Jahr 1970, als unsere Gegenwart noch in der fernen Zukunft lag, haben Alvin und Heidi Toffler in ihrem Buch Future Shock beschrieben, wie ihre Zeit der Überauswahl entgegenraste (ALVIN UND HEIDI TOFFLER, Future Shock, 1970 ). Heute ist das Klicken der richtigen Knöpfe zu einem so wesentlichen Bestandteil unseres Alltags geworden, dass wir manchmal einfach nur wegrennen möchten. — Remind me tomorrow. Register later. Während es zunächst ein Privileg ist, zwischen Produkten, Politikern, und Positionen wählen zu dürfen, besteht darin eine der größten Anstrengungen unseres Lebens. Nicht nur, weil wir zwischen mehr Angeboten und Inhalten entscheiden müssen, als wir überhaupt noch aufzunehmen bereit sind, sondern auch, weil unsere Lebensentwürfe angesichts all der Möglichkeiten, Meinungen, Haltungen und Logiken, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind, kaum konsistent, klar und kongruent sein können. Die Dissonanztheorie hilft zu erklären, warum sich heute so viele Menschen in Schwarz Weiß oder Links-Rechts Denken flüchten, anstatt differenziertere Meinungen zu bilden. Sie erklärt aber auch, warum wir uns gerade so darum bemühen, unser Konsumverhalten zu einer Art Ersatzpolitik zu erheben. Das Problem ist, dass wir größere Zusammenhänge dabei so gerne aus dem Blickfeld verlieren. Ein Gastronomiekritiker des New Yorkers hat vor ein paar Jahren geschrieben, das Verständnis von Moral und Politik vieler selbsternannter Connaisseurs sei bereits so stark geschrumpft, dass es in ihre kleinen Hanftäschchen passe (JOHN LANCHESTER, Shut up and Eat, A Foodie Repents, The New Yorker, Nov. 2014). Wer kaum über das nächste Craft-Beer hinausdenkt kann sich den Alltag einfacher machen. Aber man muss schon extrem ignorant oder naiv sein, um im Bigger Picture des eigenen Lebensentwurfs nicht hier und da Brüche zu sehen.
Im einleitenden Monolog des Woody Allen Klassikers Annie Hall erwähnt der Protagonist Alvy beiläufig, dass er immer schon Schwierigkeiten hatte, zwischen seinen eigenen Vorstellungen und der Realität zu navigieren (JUDY BERMAN, Does Annie Hall Actually Suck?, Vice US, 2017). Vierzig Jahre nachdem er in den Kinos erschien, berichtete die amerikanische Vice, der Film habe die Absichten seines Autors aus heutiger Sicht übertroffen. Im Hinblick auf die durchaus autobiographischen Züge, sei Alvy nicht nur ein extrem unverlässlicher Ich-Erzähler, der sich selbst gern reden höre, sondern werde im Film ständig von anderen, vor allem von Frauen, sehr viel schärfer beurteilt, als von sich selbst. »Was mal ein makelloser Klassiker war, ist heute ein Dokument über die Unfähigkeit eines Künstlers, der eigenen Weltsicht gerecht zu werden.«
Man kann auf Basis moralischer Prinzipientreue aufhören, Woody Allen Filme zu gucken. Man kann sie aber auch weiterhin dafür lieben, dass sie, mit ziemlich viel Witz und Verstand, von den Widersprüchlichkeiten des Lebens erzählen. Bestimmt ist auch das eine Art der Dissonanzreduktion. Aber eine, die dafür spricht, sich Unzulänglichkeiten und Unsicherheiten zu stellen, anstatt sie gleich argumentativ vom Bildschirm zu wischen. Cate Blanchett, die eine Hauptrolle in Allens Blue Jasmine gespielt hat, hat ihre Haltung in der Angelegenheit kürzlich mit den Worten »it’s complicated« beschrieben (CATE BLANCHETT, Amanpour, CNN, 2018). Es ist ein »Beziehungsstatus«, den man in Bezug auf die eigenen Überzeugungen und Entscheidungen immer häufiger anklicken möchte. Wenn es in den Bestsellerlisten mehr Ratgeber als Romane gibt, im Internet immer mehr Life-Coaches, und letztere anfangen, Kurt Cobain zu zitieren, dann zeigt das, dass die Frage, an was wir glauben und wie wir leben wollen, heute schwieriger zu beantworten ist, als jemals zuvor.

Question Mark Bottle
Wir lieben unsere Privilegien, vor allem aber die Linientreue — nicht nur in der Politik, sondern vor allem dann, wenn es um uns selbst geht, um unser Gewissen. Soziologen wie Festinger erklären die Dissonanzreduktion nicht als Folge einer bewussten Entscheidung, sondern als eine Art »Default« des Denkens. Aber wenn wir uns dem Impuls, inneren Konflikten aus dem Weg gehen zu wollen, nicht häufiger widersetzen, stärken wir damit eine Hypothese, die gerade scheinbar ständig Unterstützer gewinnt: Wer klare Prinzipien verfolgt, wird weit kommen, wessen Leben hingegen nicht passgenau konzipiert ist, der macht sich angreifbar, büßt also nicht nur kostbare Lebenszeit ein, sondern auch Integrität. Dabei beruht die Intelligenz, die man den Menschen mitunter offensichtlich zu Unrecht nachsagt, nicht zuletzt auf der Fähigkeit, die eigenen Positionen immer wieder aufs Neue zu hinterfragen. Also auch darauf, zu den Inkongruenzen im eigenen Denken zu stehen, obwohl sie einem gerade nicht ins Konzept passen. Im Wort »Konzept« steckt eine Spannung, nicht nur wegen seinem zischenden Z, dem typographischen Äquivalent eines spiegelverkehrten Hochspannungszeichens. Per Definition verbinden Konzepte zwei Dinge, die zwar nicht direkt widersprüchlich, aber auch oft nicht ganz einfach miteinander vereinbar sind: die Klarheit und die Komplexität. Konzepte möchten anspruchsvolle Anläufe oder Ideen in funktionale, möglichst griffige Form bringen. Oft ist beides aber ebenso wenig unter einen Hut zu bringen, wie manch Ideal mit dem Ist-Zustand des eigenen Lebens. Oder der gesunde Optimismus mit dem vorsichtigen Blick in die Zukunft. Bestimmt liegt unserem Anspruch, immer bewusster leben zu wollen und möglichst klarere Vorstellungen zu vertreten nicht bloß der Wille zugrunde, die Welt ein bisschen besser zu machen, sondern vor allem eine existentielle Verunsicherung. Aber auch wenn wir noch keine konkrete Idee haben, wie eine Zukunft, die nicht smarter, sondern tatsächlich intelligenter ist, aussehen könnte: Ein wichtiger Schritt wäre, damit aufzuhören, sich in scheinbar klare Konzepte, Prinzipien und Positionen zu flüchten. Wie Marcel Duchamp mal gesagt hat, muss man sich manchmal selbst widersprechen, um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Er hatte das auf den Geschmack bezogen, aber es gilt auch für die Idee vom »guten Leben«.